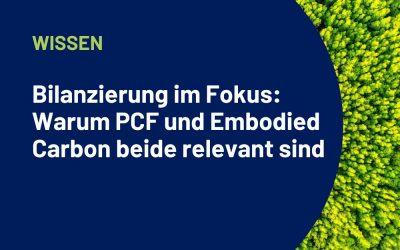Ein Überblick über relevante Normen für eine nachhaltige Bilanzierung der Umweltauswirkungen
Ein Artikel aus unserer Reihe
Standards für eine nachhaltige Zukunft: Normen für Nachhaltigkeit und Innovation
Die Notwendigkeit, Treibhausgasemissionen systematisch zu erfassen und zu senken, ist angesichts der Klimakrise und den hiermit verbundenen EU-Vorgaben zu einem zentralen Ziel für Unternehmen geworden.
Dies hat die Entwicklung von Standards und Normen für das Berechnen und Berichten der Umweltauswirkungen einzelner Unternehmen und Produkte entscheidend vorangetrieben. Dabei unterscheidet man zwischen Normen auf der Unternehmensebene, die die Emissionen des gesamten Unternehmens erfassen, und produktbezogenen Normen, die die Umweltauswirkungen einzelner Produkte umfassen. Insbesondere die Treibhausgasemissionen sind eine zentrale Umweltauswirkung, die in den Fokus geraten ist.
Dieser Artikel bietet einen Überblick über die wichtigsten Normen im Kontext der Umweltauswirkungen auf Produktebene, erläutert die Rolle der zentralen Organisationen und der einzelnen Standards, sowie der speziell für Europa entwickelten PEF-Normen und deren praktische Anwendung in Umweltproduktdeklarationen (EPDs).
Hintergrund: Der Ursprung neuer Normen und Standards – Normungsorganisationen

Auf globaler Ebene übernimmt die International Organization for Standardization (ISO) die zentrale Verantwortung für die Entwicklung weltweit gültiger Standards in unterschiedlichsten Bereichen, einschließlich Umweltmanagement und Klimaschutz. Ihre Normen finden Anwendung in zahlreichen Branchen und bieten eine einheitliche Basis für Carbon Accounting und Ökobilanzen. Ergänzt wird die ISO durch europäische Normungsorganisationen wie CEN und CENELEC, die ISO-Normen häufig in europäische Standards (EN) umwandeln, um regionale Anforderungen und Gesetzgebungen zu berücksichtigen.
Auf nationaler Ebene schließlich setzen Institute wie das Deutsche Institut für Normung (DIN) internationale Normen in nationale Kontexte um und gewährleisten die Anpassung an nationale Gegebenheiten.
Einen detaillierten Überblick zu den Normungsorganisationen gibt es hier in unserem Insights-Artikel.
Normen auf Produktebene: EPF vs PEF
Normen auf Produktebene: Von der Ökobilanz zur Carbon Footprint-Norm
Ein zentraler Ausgangspunkt für die Bilanzierung der Umweltauswirkungen eines Produktes ist die Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA), festgehalten in den ISO-Normen ISO 14040 und ISO 14044.
Diese internationalen Standards legen den methodischen Rahmen für eine umfassende Bewertung der Umweltwirkungen eines Produkts über dessen gesamten Lebenszyklus fest.
Hierauf basierend gibt es einen weiteren wichtigen Standard, die ISO 14025, zu beachten. Sie ist ein internationaler Standard, der Grundsätze und Verfahren für Umweltkennzeichnungen und -deklarationen vom Typ III festlegt, auch bekannt als Environmental Product Declarations (EPDs).
Für spezifische Produktkategorien gibt es die Product Category Rules (PCRs), die auf der ISO 14025 basieren. PCRs geben spezifische Anforderungen für die Bilanzierung und Berichterstattung von Umweltauswirkungen für bestimmte Produktkategorien vor. Sie umfassen eine Reihe spezifischer Regeln oder Richtlinien für eine Produktkategorie und können in ihrer Methodik und ihrem Umfang variieren, da sie oft von verschiedenen Organisationen oder Industrieverbänden entwickelt werden. Der Umfang der PCRs kann sehr unterschiedlich sein und reicht von spezifischen Produkten (wie Aluminiumfensterrahmen) bis hin zu ganzen Produktklassen (wie Chemieprodukte).
Zur Offenlegung der nach den PCRs berechneten Umweltauswirkungen dient eine Environmental Product Declaration (EPD), welche in der ISO 14025 definiert ist. Sie umfassen Aspekte wie Carbon Footprint, Energieverbrauch und Ressourcennutzung und ermöglichen eine klare, nachvollziehbare und vergleichbare Darstellung der Umweltwirkungen. Eine EPD ist somit ein zentraler Bestandteil der Umweltkommunikation auf Produktebene und ermöglicht es, durch standardisierte Daten eine klare, nachvollziehbare und vergleichbare Darstellung der Umweltwirkungen zu schaffen. Dementsprechend werden neue PCRs häufig von EPD Programmbetreibern veröffentlicht.

Übersicht der internationalen und europäischen Rahmenbedingungen für die Berechnung der Umweltauswirkungen einzelner Produkte.
Normen auf Produktebene: Von der Ökobilanz zur Carbon Footprint-Norm
Die Europäische Kommission hat den Product Environmental Footprint (PEF) als Weiterentwicklung der ISO-Standards für Ökobilanzen (ISO 14040/44) eingeführt.
Der PEF bietet einen umfassenden Ansatz zur Bewertung von Umweltauswirkungen von Produkten, der neben dem CO₂-Fußabdruck auch Aspekte wie Wasserverbrauch und Ressourcennutzung berücksichtigt. Obwohl die PEF-Methode nicht vollständig ISO-konform ist, standardisiert sie die Umweltbewertung von Produkten innerhalb Europas.
Für spezifische Produktkategorien wurden im Rahmen der PEF-Initiative die Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) entwickelt. Diese sind das Pendant zu den Product Category Rules (PCRs) und dienen als Grundlage für die Durchführung von PEF-Studien. Eine PEF-Studie ermittelt den Umwelt-Fußabdruck eines spezifischen Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus, basierend auf den Vorgaben der entsprechenden PEFCRs. Eine PEF-Studie ist dementsprechend das PEF-Pendant zur einer EPD.
Die PEFCRs werden in Zusammenarbeit mit Marktführern und LCA-Fachleuten erstellt und zielen darauf ab, die Reproduzierbarkeit, Relevanz und Konsistenz von PEF-Studien zu verbessern.
Obwohl die Europäische Kommission die Details der PEF noch ausarbeitet, können Unternehmen bereits PEFCRs mit diesen Richtlinien entwickeln. Bei der Entwicklung einer neuen PEFCR wird zunächst nach existierenden PCRs gesucht. Geeignete PCRs können als Basis dienen und entsprechend angepasst werden.
Was ist nun der Unterschied zwischen PCRs und PEFCRs?
PCRs basieren auf der ISO 14025 und werden oft von verschiedenen internationalen Organisationen oder Industrieverbänden entwickelt, was zu Variationen in Methodik und Umfang führen kann. PEFCRs hingegen sind Teil der PEF-Initiative der Europäischen Kommission und zielen auf einen stärker harmonisierten und umfassenderen Ansatz im EU-Kontext ab.
Während PCRs als Grundlage für Umweltproduktdeklarationen (EPDs) dienen, sind PEFCRs speziell auf die Durchführung von PEF-Studien ausgerichtet.
PEFCRs streben eine höhere Vergleichbarkeit und Konsistenz zwischen Produkten derselben Kategorie an, indem sie detaillierte Regeln für die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks vorgeben. Insgesamt bieten PEFCRs einen stärker standardisierten Rahmen für Umweltbewertungen, während PCRs flexibler auf spezifische Branchenbedürfnisse eingehen können.
Fokus auf Carbon Accounting: Greenhouse Gas Protocol und ISO 14067

Der CO2-Fußabdruck ist ein zentraler Aspekt bei der Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts. Als weitverbreitete und standardisierte Messgröße basiert die Berechnung der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts auf etablierten Standards.
Die Erfassung von Treibhausgasemissionen kann sowohl auf Produkt- als auch auf Unternehmensebene erfolgen. Das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) stellt dabei einen wichtigen Standard dar. Es bietet umfassende Richtlinien zur Bilanzierung von Emissionen in verschiedenen Scopes, basierend auf dem Einfluss eines Unternehmens auf die Emissionsquellen. Das GHG Protocol dient als Grundlage für weitere Standards, einschließlich der ISO-Norm 140671.
ISO 14067 konzentriert sich speziell auf den Carbon Footprint von Produkten (PCF) und definiert die Methodik zur Berechnung von CO₂-Emissionen entlang des Produktlebenszyklus. Diese Norm baut auf den LCA-Standards (ISO 14040 und ISO 14044) auf und ermöglicht eine detaillierte Erfassung der Kohlenstoffemissionen im Rahmen einer umfassenden Umweltbilanzierung.
Telusio Einschätzung
Die Vielfalt und Komplexität der Normen und Standards im Bereich des Carbon Accountings und der Umweltbilanzierung spiegeln die wachsende Bedeutung dieser Themen in der globalen Wirtschaft wider. Während internationale Standards wie die ISO-Normen eine weltweite Vergleichbarkeit ermöglichen, bieten europäische Initiativen wie der Product Environmental Footprint (PEF) spezifischere und umfassendere Ansätze für den EU-Markt.
Für Unternehmen bedeutet dies einerseits eine Herausforderung, da sie sich mit verschiedenen Regelwerken auseinandersetzen müssen. Andererseits bieten diese Standards auch Chancen: Sie ermöglichen eine strukturierte und anerkannte Methode zur Erfassung und Kommunikation von Umweltauswirkungen, was sowohl für interne Verbesserungsprozesse als auch für die externe Kommunikation mit Stakeholdern von Vorteil ist.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Standards, insbesondere im Hinblick auf die Harmonisierung zwischen internationalen und europäischen Ansätzen, wird entscheidend sein für die Zukunft des nachhaltigen Wirtschaftens. Unternehmen, die sich frühzeitig mit diesen Standards vertraut machen und sie in ihre Geschäftsprozesse integrieren, werden besser positioniert sein, um zukünftige regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend umweltbewussten Marktsituation zu stärken.