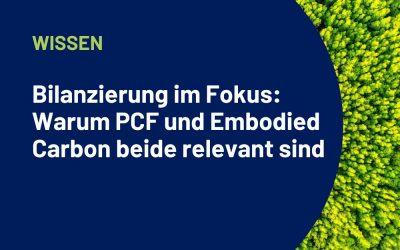Product Carbon Footprint für Anlagenbauer in der Pharmaindustrie – Warum jetzt der Moment für mehr CO2-Transparenz gekommen ist
Klimabilanzierung ist längst nicht mehr nur eine Frage von Standorten oder Fuhrparks. Immer häufiger fragen Kunden, Banken und Regulierungsbehörden: Wie viel CO2 steckt in einem einzelnen Produkt? – und erwarten klare, nachprüfbare Antworten.
Besonders im Pharmabereich, wo regulatorische Anforderungen auf komplexe Lieferketten treffen, wird die CO2-Bilanz pro Maschine zum strategischen Faktor. Der sogenannte Product Carbon Footprint (PCF) zeigt, wie klimabelastend ein Produkt von der Herstellung bis zur Auslieferung ist – und wird zum neuen Standard in der Industrie.
Einige Maschinenbauer aus dem Pharmabereich haben das erkannt und handeln bereits. So berechnet der Anlagenhersteller Bausch+Ströbel derzeit systematisch die Klimawirkung seiner Maschinen.
Was steckt hinter diesem Trend – und warum sollten andere schnell nachziehen?
Inhaltsverzeichnis
1. Vom Unternehmens-Footprint zur Produktverantwortung
Lange Zeit galt der Corporate Carbon Footprint (kurz: CCF) als zentrale Klima-Kennzahl: Wie viel CO2 entsteht an einem Unternehmensstandort, durch Energieverbrauch, Geschäftsreisen oder eigene Fahrzeuge?
Doch die Anforderungen verschieben sich. Die neue EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), Green-Bond-Richtlinien, ESG-Ratings und der Druck durch große Kunden machen klar:
Nur wer den CO2-Fußabdruck einzelner Produkte kennt, bleibt zukunftsfähig.
Im Maschinenbau betrifft das besonders Unternehmen, deren Produkte in die Wertschöpfungsketten großer, international tätiger Kunden eingehen. Wer etwa Anlagen an Pharmaunternehmen liefert, wird schnell Teil von deren Scope-3-Bilanz – und muss in Ausschreibungen oder Lieferantenbewertungen die CO2-Daten der gelieferten Maschinen offenlegen.
2. Was genau misst ein Product Carbon Footprint
Der Product Carbon Footprint (PCF) beziffert die Treibhausgasemissionen, die über den Lebensweg eines Produkts entstehen, meist angegeben in CO2-Äquivalenten (CO₂e). Dabei werden alle relevanten Emissionen aus Rohstoffen, Fertigung, Transport, Verpackung und ggf. Nutzung berücksichtigt. Im Maschinenbau hat sich dabei die sogenannte Cradle-to-Gate-Logik etabliert; von der Wiege (Rohstoffgewinnung) bis zum Werkstor des Herstellers.
Standardisiert ist die Methodik unter anderem durch:
- ISO 14067 (Kohlenstoff-Fußabdruck von Produkten)
- Greenhouse Gas Protocol – Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard
Ein entscheidender Unterschied zur unternehmensweiten CO2-Bilanz: Der PCF ist produktindividuell. Er beantwortet die Frage: Wie klimabelastend ist genau diese Maschine? Und eröffnet neue Möglichkeiten: vom Vergleich verschiedener Designoptionen bis hin zur Vermarktung als „klimafreundliches Produkt“.
3. Warum gerade die Pharmabranche den Takt vorgibt
Die Pharmaindustrie steht unter doppeltem Druck:
Zum einen durch strenge regulatorische Anforderungen, zum anderen durch Stakeholder- und Marktanforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit. Große Konzerne wie Bayer, Novartis oder Pfizer sind längst verpflichtet, Scope-3-Emissionen zu erfassen und offenzulegen – also auch die Emissionen, die durch eingekaufte Maschinen und Anlagen entstehen.
Für Maschinenbauer, deren Kunden Akteure in der Pharmabranche sind, bedeutet das:
- Wer keine produktgenauen CO2-Daten liefern kann, erschwert seinen Kunden die Nachhaltigkeitsberichterstattung
- In Ausschreibungen setzen sich zunehmend Anbieter durch, die PCF-Daten pro Maschine transparent machen
- Der PCF wird zum weichen Ausschlusskriterium – vergleichbar mit GMP-Zertifizierungen oder Lifecycle-Dokumentationen
Zugleich ist das Potenzial enorm: Anders als Konsumgüter werden Pharmaanlagen oft jahrzehntelang eingesetzt – ihr CO2-Fußabdruck wird damit Teil der Nachhaltigkeitsgeschichte ihrer Kunden.
4. Bausch+Ströbel zeigt, wie CO2-Transparenz im Maschinenbau funktionieren kann
Ein Unternehmen, das bereits vorangeht, ist Bausch+Ströbel – ein führender Hersteller von Spezialmaschinen für die Pharmaindustrie. Die Anlagen des Unternehmens reinigen, sterilisieren, befüllen und etikettieren pharmazeutische Primärverpackungen wie Ampullen, Vials oder Spritzen – in enger Abstimmung mit den strengen Anforderungen der Branche.
Seit Jahren veröffentlicht Bausch+Ströbel seinen Corporate Carbon Footprint (CCF). Doch mit dem steigenden Bedarf an produktbezogenen Emissionsdaten – sowohl von Kunden als auch aus regulatorischer Sicht – sollte nun der Product Carbon Footprint (PCF) einzelner Anlagen ermittelt werden. Die Ausgangslage war dabei nicht ungewöhnlich: Die Maschinen sind komplex und kundenspezifisch konfiguriert, die Stücklisten teils unvollständig, Datenquellen fragmentiert. Gleichzeitig fehlten intern die Ressourcen, um sich in die Berechnungslogik nach ISO 14067 oder GHG Protocol einzuarbeiten.
Trotz dieser Herausforderungen wollte das Unternehmen nicht länger abwarten – und entschied sich für eine Zusammenarbeit mit TELUSIO.
In sechs Wochen zur CO2-Bilanz einer komplexen Anlage
Der pragmatische Ansatz: TELUSIO erhielt einen rohen Datenexport aus dem ERP-System – und übernahm ab dort die strukturierte Analyse. Innerhalb von nur sechs Wochen lag der vollständige PCF einer exemplarischen Anlage vor – transparente Methodik inklusive, activity-based gerechnet auf Basis des GHG Protocol Product Standard.
Zitat Marcus Michl, Abteilungsleiter Qualitätsmanagement & Qualifizierung:
„Wir haben TELUSIO nur einen unbearbeiteten Datenabzug geschickt. Innerhalb von 6 Wochen hatten wir einen Product Carbon Footprint für unsere komplexe Anlage.“
Die Ergebnisse waren nicht nur intern aufschlussreich, sondern bieten nun auch greifbare Vorteile für Kunden: Transparenz auf Baugruppen- und Werkstoffebene, ein belastbarer Nachweis für Nachhaltigkeitsausschreibungen, sowie die Möglichkeit, Produkte künftig systematisch nach CO2-Kriterien weiterzuentwickeln.
Besonders überzeugt hat zudem der Digitalisierungsansatz: TELUSIO zeigte auf, wie der PCF in Zukunft automatisiert auf Knopfdruck bestimmt werden kann – ohne zusätzlichen Ressourcenaufwand im Tagesgeschäft.
Zitat Dr. Hagen Gehringer, Vorstand:
„Der nachvollziehbare und klare Weg zur Automatisierung der PCF-Bestimmung für alle unsere Anlagen ist sehr überzeugend.“
Bausch+Ströbel steht damit exemplarisch für einen Trend, der den gesamten Pharmamaschinenbau erfassen wird: Wer heute beginnt, CO2-Transparenz auf Produktebene zu schaffen, baut sich einen strategischen Vorsprung für morgen.
Hier gibt es die Success Story nochmal im Detail.
5. Strategische Lehren für den Pharmamaschinenbau
Der Product Carbon Footprint ist mehr als eine technische Kennzahl – er wird zur strategischen Steuerungsgröße. Wer ihn kennt, kann:
- Produktdesigns vergleichen – etwa Aluminium vs. Edelstahl oder Schweißbaugruppe vs. Gussteil
- Nachhaltigkeit belastbar kommunizieren – und so ESG-Anforderungen erfüllen
- Sich in Ausschreibungen differenzieren – gegenüber Anbietern ohne CO2-Transparenz
- Zukunftsfähige Finanzierung sichern – etwa durch Green Bonds oder ESG-verknüpfte Kreditlinien
Die Voraussetzung dafür: frühzeitig anfangen. Denn Datenqualität, Lieferanteneinbindung und interne Prozesse aufzubauen, braucht Zeit. Wer erst handelt, wenn der erste Kunde CO₂e-Werte einfordert, ist zu spät dran.
Fazit: CO2-Wissen ist Zukunftswissen
Der Product Carbon Footprint wird zum neuen Standard – nicht nur im Konsumgüterbereich, sondern auch im industriellen Anlagenbau. Pharmaunternehmen sind längst dabei, ihre Scope-3-Emissionen systematisch zu erfassen – und erwarten von ihren Lieferanten die nötigen Daten.
Bausch+Ströbel zeigt, wie ein Maschinenbauer proaktiv Verantwortung übernimmt und daraus strategische Vorteile ableitet.
Für alle anderen gilt:
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den CO2-Fußabdruck der eigenen Produkte zu berechnen. Wer heute beginnt, verschafft sich nicht nur Glaubwürdigkeit – sondern auch einen echten Vorsprung im Wettbewerb um nachhaltige Kundenbeziehungen.