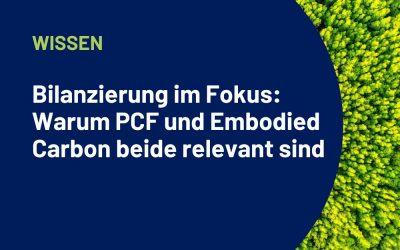Der Batteriepass: Wer ist betroffen? Welche Fristen gelten für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks?
Die Europäische Union treibt mit der neuen EU-Batterieverordnung (EU 2023/1542) den Wandel in der Batteriewirtschaft entscheidend voran. Ein zentraler Bestandteil dieser Verordnung ist der digitale Batteriepass, womit zahlreiche Batterien ab Februar 2027 ausgestattet sein müssen.

Dieser Pass enthält umfassende Informationen zum Lebenszyklus einer Batterie, angefangen von der Rohstoffbeschaffung bis hin zur Entsorgung und dem Recycling.
Eine besonders bedeutende Neuerung der Verordnung ist die verpflichtende Berechnung des CO₂-Fußabdrucks der Batterien im Batteriepass.
Diese Berechnung wird Transparenz in der Produktion und Nutzung von Batterien schaffen und birgt für Unternehmen sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Für manche Batterien ist diese Berechnung bereits ab 2025 verpflichtend, während der Batteriepass erst ab 2027 vollständig zu veröffentlichen ist.
Eine frühzeitige Vorbereitung auf diese Anforderungen ist daher unerlässlich.
Laden Sie sich für mehr Informationen zum Thema Batteriepass unser Whitepaper herunter.
Die verschiedenen Batterietypen
Die EU-Batterieverordnung führt spezifische Kategorien von Batterien ein, für die unterschiedliche Anforderungen und Fristen im Rahmen des Batteriepasses gelten. Unternehmen müssen die Anforderungen an die folgenden Batterietypen genau kennen, um sicherzustellen, dass sie die rechtlichen Vorgaben einhalten:
Die folgenden Batteriearten werden unter Anderem unterschieden:
- Elektrofahrzeugbatterien:
Batterien, die speziell zur Traktion von Hybrid- und Elektrofahrzeugen verwendet werden. - Industriebatterien:
Diese Batterien haben eine Kapazität von mehr als 2 kWh und werden in industriellen Anwendungen verwendet. - Batterien für leichte Verkehrsmittel (LV-Batterien):
Batterien, die beispielsweise in E-Bikes oder E-Scootern zum Einsatz kommen.
Stufenweise Einführung der CO₂-Berechnung und Höchstwerte
Die Einführung des CO₂-Fußabdrucks als Leistungskriterium einer Batterie erfolgt stufenweise. Zunächst wird das Berechnen des Emissionswertes verpflichtend, gefolgt von der Einordnung der Batterien in sogenannte Leistungsklassen. Als letzten Schritt werden Emissionshöchstwerte definiert, welche Batterien einhalten werden müssen, um weiterhin auf dem EU-Markt vertrieben werden zu können.
Bei der Einführung dieser Maßnahmen gibt die EU verschiedene Fristen, basierend auf den verschiedenen Batteriearten vor.
Unternehmen müssen sich frühzeitig auf diese Anforderungen vorbereiten, um die komplexen Fristen und Berechnungsvorgaben zu erfüllen.
Stufe 1: CO₂-Erklärung (ab 2025)

In der ersten Stufe müssen Batteriehersteller eine CO₂-Erklärung abgeben, die den gesamten CO₂-Fußabdruck der Batterie über ihren Lebenszyklus hinweg abdeckt. Diese Berechnung wird von Drittparteien geprüft und über einen QR-Code auf der Batterie öffentlich zugänglich gemacht.
Die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks umfasst mehrere Lebenszyklusphasen der Batterie:
| Beschaffung und Vorbehandlung der Rohstoffe | Dazu gehören der Abbau und die Vorverarbeitung von Rohstoffen sowie deren Transport. |
| Herstellung des Hauptprodukts | Dieser Schritt beinhaltet die Produktion der Batteriezellen und die Montage der Batterie. |
| Vertrieb | Der Transport der fertigen Batterie zu den Verkaufsorten. |
| Ende der Lebensdauer und Recycling | Dies umfasst die Sammlung, Demontage und das Recycling der Batterie. |
Bestimmte Phasen, wie die Nutzungsphase der Batterie und die Produktion von Geräten zur Montage oder für das Recycling, sind von der CO₂-Berechnung ausgeschlossen, da sie entweder vernachlässigbare Auswirkungen haben oder nicht direkt vom Batteriehersteller beeinflusst werden können.
Die Emissionen werden in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) pro Kilowattstunde (kWh) der gelieferten Energie berechnet und sollen detaillierte Einblicke in die CO₂-Intensität der Batterieproduktion bieten.
Fristen für die CO₂-Erklärung:
| Ab dem 18. Februar 2025 | Verpflichtende CO₂-Erklärung für Elektrofahrzeugbatterien. |
| Ab dem 18. Februar 2026 | Verpflichtung auch für wiederaufladbare Industriebatterien (ohne externer Speicherung). |
| Ab dem 18. August 2028 | Verpflichtung für LV-Batterien (leichte Verkehrsmittel, z. B. E-Bikes und E-Scooter). |
| Ab dem 18. August 2030 | Verpflichtung für wiederaufladbare Industriebatterien mit externer Speicherung. |
Stufe 2: Kennzeichnung in Leistungsklassen (ab 2026)
Ab 2026 müssen einige Batterien basierend auf ihrer CO₂-Intensität in Leistungskategorien eingeteilt werden. Dies wird ebenfalls über einen QR-Code auf der Batterie zugänglich gemacht. Diese Klassifizierung ermöglicht es, Batterien anhand ihrer CO₂-Emissionen vergleichbar zu machen, was den Druck auf Hersteller erhöht, die CO₂-Intensität ihrer Produkte zu reduzieren.
Fristen für die Leistungsklassen-Kennzeichnung:
| Ab dem 18. August 2026 | Einführung der Leistungsklasse für Elektrofahrzeugbatterien. |
| Ab dem 18. August 2027 | Verpflichtung auch für wiederaufladbare Industriebatterien (ohne externer Speicherung). |
| Ab dem 18. Februar 2030 | Verpflichtung für LV-Batterien (leichte Verkehrsmittel, z. B. E-Bikes und E-Scooter). |
| Ab dem 18. Februar 2032 | Einführung der Leistungsklasse für wiederaufladbare Industriebatterien mit externer Speicherung. |
Stufe 3: Einführung von CO₂-Höchstwerten (ab 2028)
In der letzten Stufe werden für bestimmte Batterien Höchstwerte für den CO₂-Ausstoß festgelegt. Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Batterien diese Grenzwerte nicht überschreiten, um weiterhin in der EU verkauft werden zu dürfen. Diese Höchstwerte sind der nächste Schritt zur Senkung der Emissionen und werden nach Batterieart gestaffelt eingeführt.
Fristen für die Einführung von Höchstwerten:
| Ab dem 18. Februar 2028 | Einführung von Höchstwerten für Elektrofahrzeugbatterien. |
| Ab dem 18. Februar 2029 | Einführung für wiederaufladbare Industriebatterien (ohne externe Speicherung). |
| Ab dem 18. August 2031 | Einführung für LV-Batterien (leichte Verkehrsmittel, z. B. E-Bikes und E-Scooter). |
| Ab dem 18. August 2033 | Gilt für wiederaufladbare Industriebatterien mit externer Speicherung. |
Der Batteriepass – Bedeutung für Unternehmen:
Jetzt handeln, um vorbereitet zu sein
Die Anforderungen an die CO₂-Fußabdruckberechnung (PCF) und die Einhaltung von Höchstwerten stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Die Erfassung und Analyse der benötigten Daten erfordert eine enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette und den Einsatz neuer Technologien, um die geforderten CO₂-Daten in Echtzeit bereitzustellen.
Fehlt der Batteriepass oder wird die CO₂-Berechnung nicht korrekt oder fristgerecht abgegeben, kann dies zum vollständigen Verlust des Marktzugangs führen. Die EU-Regularien sind strikt, und Batterien, die die vorgeschriebenen Daten nicht liefern, dürfen nicht auf den Markt gebracht werden.
Unternehmen, die jetzt handeln und sich auf diese Anforderungen vorbereiten, können jedoch erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen. Insbesondere die Einführung der Leistungsklassen und Höchstwerte bietet Chancen: Unternehmen, die bereits frühzeitig in emissionsarme Produktionsmethoden investieren und den CO₂-Fußabdruck ihrer Batterien optimieren, werden langfristig wettbewerbsfähiger sein. Darüber hinaus wächst das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei Verbrauchern und Investoren stetig, sodass Unternehmen, die ihre Produkte als umweltfreundlicher positionieren können, von einem positiven Marktzugang profitieren.
Telusio Einschätzung
Die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks und die neuen Anforderungen an Batterien in der EU bieten Unternehmen sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Wer sich frühzeitig vorbereitet, wird in der Lage sein, nicht nur die strengen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, sondern auch die strategische Vorteile zu erzielen.
TELUSIO unterstützt Unternehmen dabei, sich erfolgreich auf die Anforderungen der EU-Batterieverordnung vorzubereiten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu handeln – für eine nachhaltige Zukunft und den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens.